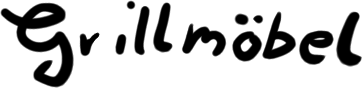01 Feb 2015
serenators and incinoritas
Die Leute können sagen, was sie wollen, für mich ist „Lick my Decals off, baby“ einfach das beste Album von Captain Beefheart. Jetzt wollte ich gerade lustig sein und habe den Albumtitel bei Google News eingegeben, um mir selbst und ggfls den Grillmöbelkunden („Kunde“ hier als nicht-binäres Abstraktum) zu beweisen, dass es seit Jahrzehnten keinen Artikel gab, der sich mit diesem Album beschäftigte, doch siehe da: Die Presse!! Es wird also endlich in Plattenläden auch außerhalb Japans zu erstehen sein! Obwohl ich es im Grunde gar nicht erstehen müsste, denn es ist auch auf Youtube. Aber manche Alben der Musik sollte man einfach besitzen. Warum? Ganz klar: Trout Mask Replica mag die beefhearteske Revolution geliefert haben, das kann ich jederzeit guten Gewissens unterschreiben, aber „Lick my Decals off, baby“ erscheint mir gewissermaßen als das Ergebnis des Experiments „Trout Mask Replica“, als hätten Beefheart und die Magic Band aus dieser Grundlage eines wirren Sammelsuriums voller Unglaublichkeiten eine Sammlung von Titeln hergestellt, die alle Anforderungen daran erfüllen, „Lied“ oder „Song“ genannt werden zu dürfen (sie sind zwischen 2 und 5 Minuten lang, enthalten mit Instrumenten erzeugte Geräusche, haben gewisse Strukturen, jemand singt, also alles easy eigentlich). Und sich ausgerechnet damit noch viel weiter vom Pop entfernt als jemals zuvor (oder danach). Denn auch nur einen Track dieses Albums auf eine Stufe mit einem beliebigen „Lied“ oder „Song“ zu stellen durch eine entsprechende Benennung wirkt unangebracht. Dieses Album lässt einer zuhörenden Person keine andere Wahl als es zu mystifizieren und das völlig zu Recht, denn wissenschaftlich erklärbar ist nicht, was da passiert. Klar kann man sowas sagen wie „Captain Beefheart kombiniert hier Free jazz- Einflüsse mit seiner alten Liebe, dem Blues“, aber das ist Blödsinn, wenn man über den Entstehungsprozess der Musik von Captain Beefheart Bescheid weiß. Es ist eben halt genau nicht „Ich habe den großen Überblick und kombiniere hier bewusst zwei Musikgenres, die es gibt“. Dass so etwas gesagt wird (und das wird es immer wieder) ist vielmehr dem Unvermögen geschuldet, echte Musik zu beschreiben, die eben nicht nach dem Musik-Regelwerk komponiert und produziert wird. Hier passiert Musik, wie sie passieren soll, nämlich durch Ideen und vor allem in erstaunlicher und unbewusster Missachtung musikalischer Erwartungen und Konventionen. „Lick my Decals off, baby“ ist wie ein erdnaher Asteroid, dem es völlig Wurst ist, ob er alles Leben hier auslöscht (Nihilismus ahoi!) oder nur schick fürs Auge an uns vorbeifliegt. Niemand wusste, was die Platte mit den Menschen macht, die sie hören (während ich mich eher frage, was mit den Menschen ist, die sie nicht hören). Letztlich ist nicht viel passiert, es war wie jedes Captain Beefheart-Album nicht besonders erfolgreich, aber zum Glück lassen wir uns hier auf Grillmöbel ja nicht vom entfesselten Turbokapitalismus definieren, was ein Album gut macht (denn die Verkaufszahlen sind das selbstverständlich nicht. Hat doch garnichts miteinander zu tun, überleg doch mal! Wohl bekloppt!) und immerhin hat John Peel sich Mühe gegeben, möglichst vielen Leuten die Möglichkeit zu geben, „Lick my Decals off, baby“ zu hören. Ist das nicht eine fast unglaubliche Vorstellung, dass 1970 im Radio das hier gespielt wurde, während heute nur noch Autotune-Talente über strategisch errechnete Melodien nicht singen? Egal, einen Hasspost über Popmusik 2015 gibt es ein andermal, falls ich das Thema jemals relevant genug finde. Wie dem auch sei, jedenfalls spricht auch aus den über Jahrzehnte zusammengekommenen Reviews (siehe Internet unter Album Reviews Lick my Decals off, baby) derselbe Mystizismus, den ich weiter oben diagnostiziert habe. Die professionellen Kritiker_innen scheinen schlicht überfordert zu sein, irgendwas zu schreiben, weshalb die Reviews auch teilweise ziemlich albern sind. ZB schreibt jemand (Wikipedia): „In a way this is his most intellectual work, because the album takes the traditional topics of blues, eroticism, freedom, trains and nostalgia, and sets them in a modern context of city alienation“. Aha, es ist also ein intellektueller Höhepunkt, weil die traditionellen topoi Blues, Erotik, Freiheit, Züge und Nostalgie in einen modernen Kontext städtischer Entfremdung gesetzt werden. Hä? Ich glaube, ich schreibe demnächst einfach mal ein Lied, das die traditionellen Themen Folklore, Liebe, Geschichten, Rote Bete und Bundesanstalt für Arbeit in den Kontext eines Boxkampfes stellt und warte ab, ob das irgendjemand bemerkt. So an „das Werk“ (Reviewsprache) von Captain Beefheart heranzugehen ist ungefähr so angebracht wie in jedes „sie seufzte“ eines Gedichts brutal einen sinnstiftenden Stabreim (oh, und hier gleich noch einer! Hehe) hineinzuinterpretieren. Kleiner Tipp für die Rezensierenden: Wer ständig Parts auf Instrumenten einspielt, ohne sie zu beherrschen und Texte über großäugige Bohnen von der Venus singt, meint vielleicht nicht alles ernst und funktioniert vor allem anders. Der Mystizismus jedenfalls dringt sogar bis zu den beteiligten Leuten selbst, denen das Album nun ja eigentlich kein Rätsel sein sollte, gibt doch sogar Bassist (obwohl selbst so eine Bezeichnung irgendwie fehl am Platz wirkt) Rockette Morton in dieser großartigen Dokumentation zu Protokoll, dass er sich nicht mal erinnern kann, die Tracks gelernt oder gar gespielt zu haben. (Auch gut: Gegen-Captain-Beefhearts-Willen-Captain-Beefheart-Biograph Mike Barnes, da er zwar durchaus eine intellektuelle Analyse vornimmt, aber nur von dem, was da ist und nicht von dem, was dahinter steckt und rein spekulativ ist. Das aber bitte selbst nachlesen.) Interessant ist, wie sich die Wahrnehmung des Albums verändert hat, je öfter ich es gehört habe. Zunächst dachte ich: Ah, cool, mehr Trout Mask-Albernheiten. Ein paar Mal später dachte ich: Wow, Doctor Dark ist irgendwie cool. Noch später: Ok, was geht ab bei Space Age Couple? Dann: Ah, jetzt kommt dieser komische Teil, wo er irgendwas brüllt, während das Sopransaxophon irgendwelchen Unsinn spielt, die restlichen Musiker aber eine sehr sanfte und gefühlvolle Melodie spielen. Jetzt kann ich das Album nur noch als Ganzes hören, wie ein einziges halbstündiges Lied. Klar habe ich da auch Vorlieben („The Clouds are full of wine, not Whisky or Rye“, „I love you, big Dummy“, „Doctor Dark“ ist nicht nur Mike Barnes’ Lieblingssong von Captain Beefheart), aber mittlerweile brauche ich sogar „Petrified Forest“ und „Japan in a dishpan“, um mich wohlzufühlen. Einzig „Flash Gordon’s Ape“ bleibt immer noch anstrengend anzuhören, mal gespannt, nach dem wievielten Hören sich das ändert. Aber vielleicht ist das ja sogar so intendiert und zeigt uns, dass es im Zustand urbaner Entfremdung kein Happy End gibt, egal wie sehr wie uns um Zugnostalgie bemühen. Ja, doch, diese Deutung schreit der Affe einem doch geradezu ins Gesicht. Ich lasse nun kurz von dem unbekannten Kritiker ab, um festzustellen, dass, während auf anderen Beefheart-Alben die einzelnen Songs als Songs stärker sind, hier eine Art 15-Gänge-Menü für die Ohren serviert wird hier etwas geschaffen wurde, was sich jeder bekannten Herangehensweise (zum Glück) prinzipiell entzieht und dadurch nur eine Wahl lässt, nämlich sich im jeweiligen Moment ehrlich auf die Musik einzulassen. Mehr davon wäre großartig, aber es kann auch nur ein „Lick my Decals off, baby“ geben, denn wer könnte sich einen anderen Titel ausdenken, in dem Blues, Erotik, Freiheit, Züge und Nostalgie derart miteinander harmonisieren? Ich nicht. Captain Beefheart vielleicht.